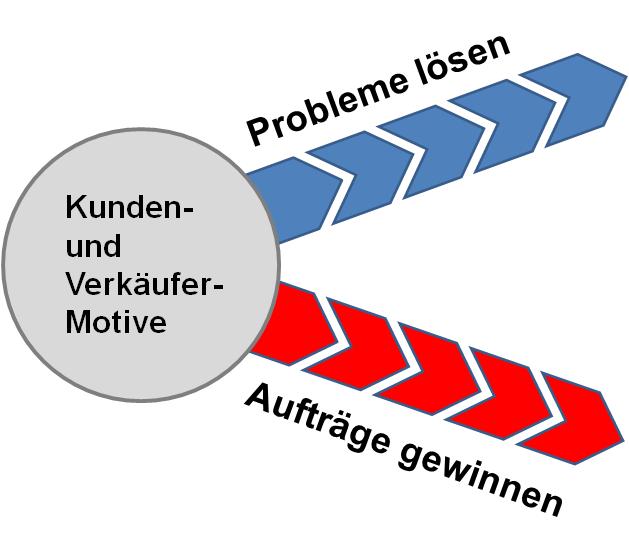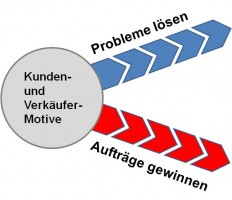Untersuchte Unternehmen zeigten: 38% aller Kunden erwirtschafteten Verluste und blieben unentdeckt. Den Verlust dieser Kunden auf Null zu reduzieren würde das Betriebsergebnis mit einem Sprung um mehr als 100% nach oben treiben.
Unternehmensleitungen schenken dem Thema Profitabilität wenig Aufmerksamkeit, im Wesentlichen aus drei Gründen:
1. Es gibt keinen verantwortlichen „Kümmerer“ für Profitabilität
Am Ende des Tages ist natürlich stets die Geschäftsführung für mangelnde Profitabilität im Unternehmen verantwortlich. Aber funktional teilen sich die Verantwortung der Vertrieb – für die durchgesetzten Preise im Markt – und die für die Leistungserstellung verantwortlichen Führungskräfte, unterstützt von Abteilungen, die u.a. eine (Produkt-) Kalkulation durchführen. Die nicht unbeträchtlichen Gemeinkosten sind über alle anderen Funktionsbereiche im Unternehmen verteilt und werden oft über Gemeinkostenschlüssel in der Produktkalkulation berücksichtigt. Dies erweist sich zunehmend als problematisch: kleine Auftragsgrößen müssten stärker belastet werden, größere Aufträge könnten dagegen entlastet werden.
In den 80er Jahren machten die direkten Kosten ca. 80% der Gesamtkosten aus, heute sind es eher nur noch rund 60%. Deshalb sind die beliebten Deckungsbeitragsrechnungen heute auch immer kritischer hinsichtlich ihrer Aussagekraft zu bewerten. Der große Block der Gemeinkosten hat sich zur schweren Bürde nicht nur für die Kosten-Transparenz, sondern auch für die Profitabilität der einzelnen Kunden entwickelt.
2. Es gibt keine Transparenz der Kundenprofitabilität
Die Kosteninformationen des Rechnungswesens dienen mit ihren Angaben zu Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern eher der Gesamtkosten-Information der Kostenstellenverantwortlichen und der Feststellung der Besteuerungsgrundlage. Der Bezug zur Leistungserstellung und zu den abgewickelten Kundenaufträgen wird im Regelfall nicht ausreichend detailliert hergestellt.
Die Kosteninformationen folgen also eher der Aufbauorganisation in Unternehmen. Kundenaufträge laufen aber „quer“ durch viele Abteilungen und nehmen über die bezogenen Produkte und Dienstleistungen Ressourcen nicht nur aus der Produktion auf. Ergänzend werden diejenigen Abteilungen beansprucht, die zur Auftragsabwicklung beitragen. Deren Beiträge pro Auftrag und pro Kunde bleiben weitestgehend dem Wert nach unbekannt. Und das sind heute immerhin rund 40% der Gesamtkosten.
Was die Kundenprofitabilität angeht, sind Unternehmen heute nahezu „blind“ und haben allenfalls eine diffuse Vorstellung von der Kundenprofitabilität im einzelnen. Unternehmen sind häufig überrascht, wie groß die Unterschiede in der Profitabilität einzelner Kunden sind, selbst wenn diese noch Erträge erwirtschaften.
3. Es gibt daher keine wirksamen Sanierungsmaßnahmen
Wenn unklar ist, wieviele Ressourcen von Kunden für die Abwicklung ihrer erteilten Aufträge beansprucht werden, können keine Sanierungsmaßnahmen greifen, die dauerhaft das Problem mangelnder Kundenprofitabilität lösen.
Daher kommt es in der Praxis ja auch zu wenig hilfreichen Maßnahmen, die zwar von der Entschlußkraft der Unternehmensleitungen zeugen, aber eben nicht von einem profunden Sachverstand der Kosten, die Kunden beanspruchen. Sei es im Vertrieb, dem Rechnungswesen, der Logistik oder in anderen Abteilungen.
Mit der „Gießkanne“ über Personalkosten, Materialkosten oder andere Kostenarten zu wirken, wird den Kunden mit unterschiedlicher Auftragsgröße und unterschiedlichem Aufwand der Auftragsabwicklung nicht gerecht.
Wie sieht eine nachhaltig wirksame Lösung aus?
Relevante Daten zur Bestimmung der Kundenprofitabilität sind im Unternehmen nahezu vollständig vorhanden: neben Kostenstellendaten, Daten der Leistungserstellung (welches Produkt hat wie lange welche Maschine und andere Ressourcen in Anspruch genommen) und Vertriebsdaten (Kundenumsätze, Aufträge, Absatzmengen pro Produkt oder Dienstleistungen) müssen nur noch die Hauptaktivitäten von Mitarbeitergruppen mit Blick auf Produkte bzw. Kunden erfasst werden. Hier reichen gewöhnlich Schätzungen der Abteilungsleiter völlig aus, um hinreichend genaue Profitabilitätsanalysen zu erhalten.
Mit diesen Daten wird eine Unternehmensmodellierung z.B. für ein Geschäftsjahr vorgenommen, alle Kosten und Umsätze der Gewinn- und Verlustrechnung fließen vollständig hier ein. Das Ergebnis zeigt die Profitabilität aller Kunden im Detail. D.h. auch die Profitabilität der Aufträge oder der bezogenen Produkte für diesen Kunden kann ausgewiesen werden. Sehr aufschlussreich sind die Kosten der Auftragsabwicklung der Kunden – hier gibt es oft signifikante Unterschiede.
So ist es einleuchtend, dass z.B. zwanzig Kleinaufträge mit geringen Umsätzen über das Jahr verteilt die Kundenprofitabilität deutlich sinken lassen im Vergleich zu einem Kunden, der den gleichen Jahresumsatz erzielt und diesen auf zwei Aufträge verteilt. Dies ist nur ein kleines Beispiel von vielen weiteren, die bei näherer Betrachtung der Fakten klar erkennen lassen, warum die Profitabilität der Kunden so unterschiedlich ist. Werden nur Durchschnitts-werte in der Abteilung „Auftragsabwicklung“ betrachtet, ist der Wert der Information gering und erlaubt keine schlüssige Abhilfemaßnahme.
Bei Kunden mit kleiner Auftragsgröße müssten entweder die Preise deutlich erhöht werden (Mindermengenaufschläge..) oder diese Kunden erhalten eine andere Form der Kundenbetreuung und Auftragsabwicklung, die z.B. erheblich kostengünstiger über einen Online-Shop abgewickelt wird. Eine derartige Maßnahme wäre über die in der Unternehmensmodellierung aufgedeckten Ursachen-Wirkungs-Beziehungen mit harten, belastbaren Fakten für jedermann einsichtig und akzeptabel. Außerdem kann diese Alternative leicht im Modell mit Blick auf die zu erwartenden Ergebnisse durchgerechnet werden.
Es ist wesentlich einfacher, den Gewinn mit gezielten Maßnahmen in der eigenen Kundenbasis um 40% zu erhöhen als den Umsatz in gleicher Höhe. Dafür lohnt sich die Suche und der Blick auf die Verlustbringer.
Interessierte Unternehmen sind eingeladen, mit ihren ausgewählten Daten einen kostenfreien Kurzcheck ihrer Kundenprofitabilität abzurufen. Das Ertragspotenzial wird ebenfalls in erster Annäherung bestimmt. Zum Kurzcheck Kundenprofitabilität geht es hier.